|
GWTF-Jahrestagung Berlin, 26. und 27. November 2010 Die Wirkung der Dinge als Problem empirischer Forschung |
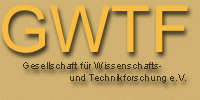
|
|
Call for Papers (pdf) | Programm mit Abstracts | Programm (pdf) GWTF Jahrestagung 2010 am 26. und 27. November 2010 an der Technischen Universität Berlin. 
Die Wirkung der Dinge als Problem empirischer Forschung
Die Materialität der Welt hat wieder Einzug in die Sozialwissenschaften gehalten und dort vor allem Großtheorien hervorgebracht oder befruchtet. Wer die Bedeutung von Natur und Technik für menschliches Handeln herausstellen will, kann dies unter Verweis auf die Actor-Network Theory tun, sich auf Konzepte von Sachen als sozialen Strukturen beziehen oder die Interaktivität der Dinge herausstellen. Demgegenüber haben die forschungspraktischen Probleme des Umgangs mit den Dingen weit weniger Aufmerksamkeit erhalten. Wer die Wirkung von technischen Artefakten und Prozessen oder von Naturphänomenen im sozialen Handeln erfassen, vergleichend beschreiben und analytisch einordnen will, findet kaum methodologische oder methodische Unterstützung. Dinge empirisch zu erforschen ist für die Sozialwissenschaften deshalb so schwierig, weil ihre natürlichen oder technischen Eigenschaften immer in Vermischung mit sozial konstruierten Bedeutungszuschreibungen wirken. Wenn Sozialwissenschaftler die Intervention des Nichtsozialen in soziales Handeln beobachten und in Erklärungen integrieren, müssen sie zwangsläufig die Domäne ihrer Disziplin verlassen und sehen sich mit genuin naturwissenschaftlichen oder technikwissenschaftlichen Fragen konfrontiert. Mit diesem Problem sind viele Fachgebiete und Disziplinen konfrontiert. Neben der Wissenschafts- und Technikforschung behandeln die Organisations-, Medien-, Architektur-, Konsum-, Wirtschafts-, Medizin-, Körper- und viele weitere Bindestrich-Soziologien Fragen, bei denen sie sich oft in technische und naturwissenschaftliche Kontexte begeben (müssen). Aber auch andere Disziplinen wie die Archäologie, Geschichte, Ethnologie, Anthropologie, Politologie und Rechtswissenschaften erforschen oft die Wirkung von technischen und/oder natürlichen Gegenständen. Nicht zuletzt verlangen Querschnittsbereiche wie Sicherheit, Mobilität oder Umwelt eine empirische Erforschung der Wirkung von Dingen. Mit der Konferenz möchten wir Kolleginnen und Kollegen aus all diesen Bereichen einladen, ihre praktischen Erfahrungen mit der Erforschung von Dingen auszutauschen. Dabei wollen wir die forschungspraktischen und konzeptionellen Probleme in den Mittelpunkt stellen, auf die wir stoßen, wenn wir die Wirkung der Dinge empirisch analysieren und erklären wollen. Wir schlagen hierzu drei Fragekomplexe vor, die sich durch alle Bereiche ziehen: 1. Wann werden technische und natürliche Gegenstände und ihre Wirkungen auf Gesellschaft relevant für sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungen? Welche unserer Forschungsfragen lassen sich ohne Rekurs auf natürliche oder technische Gegenstände beantworten, und welche erfordern eine Untersuchung der Dinge? 2. Wie können wir die Wirkungen der Dinge empirisch untersuchen und vergleichend beschreiben? Eine naheliegende und häufig angewendete Forschungsstrategie besteht darin, sich auf die Wahrnehmungen der befragten oder beobachteten Akteure zu verlassen, die mit den Dingen interagieren. Unter welchen Bedingungen reicht eine solche Strategie aus, unter welchen Bedingungen müssen wir eine von den Untersuchten unabhängige Perspektive auf die Dinge erarbeiten? Wie kann das gelingen? 3. Wie können wir die Wirkungen der Dinge in unsere disziplinär geprägten Erklärungen einbauen? Wie können wir die dafür notwendigen vergleichenden Analysen durchführen? Wie lassen sich Wirkungen der Dinge mit sozialen Faktoren in eine Erklärung integrieren? Tagungsort: 
Freitag, 26.11.2010 11:00 - 11:30 Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema. Cornelius Schubert (Berlin), Stefan Böschen (Augsburg), Weert Canzler (Berlin), Jochen Gläser (Berlin), Martin Meister (Berlin) 
BLOCK I: Disziplinäre Perspektiven 11:30 - 12:15 Jochen Gläser, Grit Laudel (Berlin): Von Quantenpunkten und Proteinen zu Zeit, Geld, Risiko und Beziehungen. Abstract als pdf 12:15 - 13:00 Anna Henkel (Bielefeld): Das Ding Arzneimittel. Abstract als pdf 13:00 - 14:00 Mittagspause 14:00 - 14:45 Daniela Seidl (München): Die Widerständigkeit der Dinge: volkskundlich-kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Wirkmächtigkeit von Materialität. Abstract als pdf 14:45 - 15:30 Tanja Zech, Stefan Schreiber (Berlin): BeDingte Interviews: Archäologische Gedanken zu Methoden der Dingbefragung. Abstract als pdf 15:30 - 16:00 Kaffeepause 
BLOCK II: Die Wirkung alltäglicher Dinge 16:00 - 16:45 Stephan Lorenz (Jena): Tatsachen schaffen – Wirkungen vermehrter Dinge. Abstract als pdf 16:45 - 17:30 Torsten Cress (Mainz): Situationen, Praktiken und die Wirksamkeit der Dinge. Das Beispiel der katholischen Liturgie. Abstract als pdf 17:30 - 18:00 Kaffeepause 18:00 - 18:45 Beate Littig (Wien): Auf Stöckelschuhen. Oder: was man von einer Praxeografie des Tangotanzen über die Wirkung der Dinge erfahren kann. Abstract als pdf 18:45 - 19:30 Mitgliederversammlung der GWTF, danach gemeinsames Abendessen. Samstag, 27.11.2010 
BLOCK III: Design und Interaktivität 10:00 - 10:45 Annina Schneller (Bern): Designrhetorik – die Wirkungen gestalteter Dinge. Abstract als pdf 10:45 - 11:00 Kaffeepause 11:00 - 11:45 Corinne Büching, Kathrin Ganz, Heide Schelhowe (Bremen): Subjekte und digitale Medien in der Interaktion. Abstract als pdf 11:45 - 12:30 Tanja Carstensen, Jana Ballenthien (Hamburg-Harburg): Aufzeichnungen und Auswertung von Internetpraktiken. Ein Vorschlag für ein empirisches Vorgehen zur Analyse der "Wirkung" digitaler Technologien. Abstract als pdf 12:30 - 13:00 Abschlussdiskussion 
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am 24.05.2018 [zum Seitenanfang] [Impressum/Datenschutzerklärung] |
|