|
GWTF-Jahrestagung Berlin, 16. und 17. November 2012 Was tun wir mit Theorien in der Wissenschafts- und Technikforschung, |
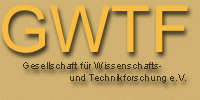
|
|
Call for Papers (pdf) | Programm (pdf) Jahrestagung der Gesellschaft für Wissenschafts- und Technikforschung am 16. und 17. November 2012 in Berlin Organisation: Stefan Böschen, Jochen Gläser, Anna Henkel, Valentin Janda, Martin Meister, Werner Rammert, Cornelius Schubert.
Was tun wir mit Theorien in der Wissenschafts- und Technikforschung,
und was tun die Theorien mit uns?
Das Verhältnis der Wissenschafts- und Technikforschung zu Theorie spiegelt die große Diversität dieses Forschungsfeldes und trägt zu ihr bei. Mit dem Strukturalismus (Merton) und dem Bestreben, Mannheims Wissenssoziologie auf naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden (Bloor), prägen zwei große sozialtheoretische Entwürfe die Anfänge der Wissenschaftsforschung. Auf der anderen Seite offerierten die wissenschaftstheoretischen Arbeiten Flecks und Kuhns forschungsleitende Erkenntnis- und Strukturmodelle der Wissenschaft. Diese theoretischen Modelle sind bekanntlich dann auch folgenreich auf die Technikforschung übertragen worden. Im weiteren Verlauf entfaltete unser Forschungsfeld, international als Science and Technology Studies, allerdings einen erheblichen Teil seiner Originalität und Eigenständigkeit durch eine diametral entgegengesetzten Herangehensweise: Prozesse der Herstellung von wissenschaftlicher Wahrheit wie der Herstellung von technischem ‚Sachzwang' wurden dabei als zunächst theoriefrei zu beforschende Praxis angesehen (Latour/Woolgar, Knorr Cetina), um die Vielfalt der instrumentellen Erkenntnispraktiken (Hacking, Rheinberger) wie der Herstellung von technischem Funktionieren (in der Technikgeneseforschung) empirisch überhaupt erst aufzudecken. Die entsprechenden Praxisansätze haben nun ihrerseits eine Vielzahl von Theorien unterschiedlicher Reichweite entwickelt. Nimmt man Bemühungen um die Integration dieser beiden Herangehensweisen und die Vielzahl der auf die Gegenstände Wissenschaft und Technik angewendeten allgemeinen, aus der Soziologie, der Philosophie, aus den Geschichtswissenschaften oder der Anthropologie stammenden Theorien hinzu, wird eine Vielzahl von Paradigmata offenbar, die in ihrem Ansatz (fokussiert auf Zentralbegriffe wie etwa Wahrheit, Gesellschaft, Institution, Organisation, Technik oder Praxis) und der beanspruchten Reichweite der Erklärung höchst heterogen sind. Geeint ist das Feld durch den gemeinsamen Bezug auf die soziale Herstellung von wissenschaftlicher Erkenntnis und technischem Funktionieren als empirischem Gegenstand - obwohl mit den verschiedenen theoretischen Positionen offensichtlich sehr unterschiedliche Bestimmungen dieser Untersuchungsgegenstände einhergehen und die Untersuchungsgegenstände selbst wiederum unterschiedliche Anforderungen an die Theorien stellen. In der Forschungspraxis der Wissenschafts- und Technikforschung wird dieser offenkundig unklare Umgang mit Theorien allerdings nur sehr selten reflektiert. Die Wahl einer leitenden Theorie ist entweder, durch Zugehörigkeit zu einem theoretischen Camp, gesetzt, oder man hat den Eindruck eines rituellen Charakters der Theorieverwendung, der Anträge und Publikationen aufwerten soll, aber den Autorinnen und Autoren nicht wirklich am Herzen liegt. Die Frage, ob und in welchen Phasen des Forschungsprozesses Theorie eingesetzt wird, um welche Art von Theorie es sich dabei handelt und welche Folgen die Wahl einer Theorie und deren Handhabung für die eigene Forschung haben, wird selten diskutiert. Die sicherlich nur relativen Vorzüge unterschiedlicher Theorien - und unterschiedlicher Theorieverständnisse - für die disziplinär gebundene als auch für die interdisziplinäre Wissenschafts- und Technikforschung bleiben außerhalb der Debatte, nicht zuletzt deshalb, weil Theorienvergleiche, vor allem wenn sie in einem gemeinsamen empirischen Gegenstand geerdet sind, so gut wie nicht existieren. Vor diesem Hintergrund wollen wir auf der diesjährigen Jahrestagung der GWTF diskutieren, welche Rolle Theorie (als Erkenntnistheorie, Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie oder Theorie mittlerer Reichweite) in unserer Forschung spielt. Wir laden Beiträge aus allen Bereichen der Wissenschafts- und Technikforschung ein, die an Beispielen aus der eigenen Forschung dieses Problem behandeln und z. B. folgende Fragen adressieren:
Tagungsort: Während der Tagung können Kinder von Referentinnen und Referenten im nahegelegenen Eltern-Kind-Zimmer der TU betreut werden (http://www.tu-berlin.de/?id=109187). Die Betreuungskosten übernimmt die GWFT.
Freitag, 16.11.2012 11:00 - 11:30 Begrüßung und Einführung in das Tagungsthema 11:30 - 12:15 Tobias Röhl (Mainz): 12:15 - 13:00 Jan-Felix Schrape (Stuttgart): 13:00 - 14:30 Mittagspause 14:30 - 15:15 Priska Gisler (Bern)/ Monika Kurath (Zürich): 15:15 - 16:00 Julian Bauer (Konstanz): 16:00 - 16:30 Kaffeepause 16:30 - 17:15 Christian Meier zu Verl (Bielefeld)/ Christian Meyer (Halle-Wittenberg): 17:15 - 18:00 Barbara Sutter (Basel): 18:00 - 18:30 Kaffeepause 18:30 - 19:15 Michael Decker (Karlsruhe): 19:15 - 20:00 Mitgliederversammlung der GWTF Anschließend Gemeinsames Abendessen Samstag, 17.11.2012 10:00 - 10:45 Jochen Gläser (Berlin)/ Grit Laudel (Twente): 10:45 - 11:30 Mario Kaiser/ Martin Reinhart (Basel): 11:30 - 12:00 Vesperpause 12:00 - 13:30 Werkstattgespräch
|
|
|
Zuletzt aktualisiert am 24.05.2018 [zum Seitenanfang] [Impressum/Datenschutzerklärung] |
|